„Wir sind für unsere Gefühle selbst verantwortlich“
An diesen Satz musste ich denken, als ich kürzlich auf dem Motorrad saß und der Fahrer auf 160 km/h beschleunigte. Mir rutschte das Herz in die Hose.
Ich kam frisch von einer Woche Bildungsurlaub zu „gewaltfreier/wertschätzender Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg und war fest entschlossen, das Konzept in meinen Alltag zu integrieren. Ein wesentliches Merkmal ist, die volle Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Menschen können auf dieselbe Situation nämlich vollkommen unterschiedlich reagieren. Die meisten anderen Motorradfahrer, die uns an diesem sonnigen Tag entgegen kamen, genossen es vermutlich, sich in die Kurven der Hochtaunusstraße zu legen. Ich schloss dagegen vorsichtshalber die Augen. Wenn ich schon sterben muss, dann will ich es lieber nicht kommen sehen.
„Für Gefühle verantwortlich zu sein, heißt nicht, an ihnen Schuld zu sein“, erklärte unsere Dozentin Jeannette Werner. Vielmehr sollen wir uns für unsere Gefühle verantwortlich fühlen wie für ein Vierjähriges Kind. Wenn sie kommen, sperren wir sie nicht in die Besenkammer, sondern kümmern uns um sie. Nicht immer können wir ihnen sofort Aufmerksamkeit schenken, aber später am Tag nehmen wir uns Zeit, sie zu fühlen. Wichtig ist, dass wir dabei im Chefsessel sitzen und dem Gefühl nicht gestatten, die Macht zu übernehmen. Soviel zur Theorie.
„Das ist schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte.“
Praktisch stieg ich auf das Motorrad und dachte beim Anfahren: „Das ist schlimmer, als ich es zuletzt in Erinnerung hatte.“ Mir fiel auf Anhieb auch keine der Techniken ein, die wir letzte Woche zum Umgang mit starken Gefühlen gelernt hatten. Ich wusste nur, dass ich der Chef bleiben wollte, und dazu dürfte ich nicht nachdenken bzw. mir ausmalen, was alles passieren könnte.
Das erste, das mir einfiel, war die Meta-Meditation, weil ich sie regelmäßig übe. Sie beschränkt sich auf vier einfache Sätze: „Möge ich sicher sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben.“ Ich brauche kaum zu sagen, dass die Betonung auf dem ersten Satz lag. Nach mehreren Wiederholungen, in denen ich auch den Fahrer einschloss, fühlte ich mich ruhiger.
Ich versuchte, den Körper zu entspannen und mich nicht verkrampft an den Fahrer zu klammern. Der hatte inzwischen die Autobahn erreicht und gab Gas. Wie ich es beim letzten Mal gelernt hatte, duckte ich mich auf meinem erhöhten Sitz hinter ihn und presste meinen Kopf mitsamt Helm in sein Kreuz, damit der Fahrtwind mich nicht nach hinten riss. Meine Hände lagen gut verschränkt zwischen dem Bauch des Fahrers und dem Tank.
Was meine Jungs wohl von mir denken würden
Manchmal blinzelte ich ein wenig zur Seite und sah die weiße Markierung des Seitenstreifens oder die Leitplanke vorbeirasen. Dann sah ich auf die Innenseite des Visiers, in dem sich übergroß ein Teil meines Gesichts spiegelte. Alle meine Falten und Fältchen waren deutlich zu sehen und ich fragte mich, was meine erwachsenen Jungs wohl denken würden, wenn sie wüssten, dass ich mit über 50 Jahren so etwas Gefährliches mache.
Als wir die Autobahn verließen, wurde ich kühner. Ich setzte mich etwas aufrechter und schaute mir die vorbeiziehende Landschaft an: Rapsfelder, blühende Bäume, das erste frische Grün des Waldes am Feldberg. Bei den Serpentinen schloss ich wieder die Augen und versuchte nur zu fühlen, wie ich mein Gewicht verlagern muss, wenn die Maschine sich in die Kurve legt.
Als wir die Serpentinen in anderer Richtung hinab fuhren, wurde ich wieder mutiger und sah in den Rückspiegel. Hinter uns waren noch vier andere Motorräder. Vor uns verhinderte ein Auto eine schnellere Fahrt durch die Kurven. An Überholen war nicht zu denken. Bisher war mein Fahrer mit Rücksicht auf mich moderat gefahren. Aber ich war mir nicht sicher, ob er sich von anderen Motorradfahrern überholen lassen würde, sobald die Bahn wieder frei war. Zum Glück kamen wir nicht in die Situation, weil unsere Wege sich trennten.
Als die Fahrt zu Ende ging, fand ich es fast schade
Zurück auf der Autobahn ging ich wieder in geduckte Stellung und auf Innenschau. Nach einiger Zeit fiel mir auf, dass meine Gedanken abgeschweift waren und ich mich nicht mehr aktiv davon abhalten musste, an Gefahren durch geplatzte Reifen oder unachtsame Autofahrer zu denken. Ich fragte mich auch nicht mehr, wie es sich wohl anfühlt, schwer verletzt in einen Krankenwagen geschoben zu werden und ob ich diese Fahrt dann bereuen würde, weil mein Leben nie wieder so sein würde wie vorher.
Ich traute mich jetzt sogar, am Fahrer vorbei auf den Tacho zu schauen: 160 km/h. Im Schönwetterdunst tauchte vor uns wieder die Skyline von Frankfurt auf. Jetzt fand ich es fast ein bisschen schade, dass die Fahrt zu Ende ging. Als ich vom Motorrad stieg und dem coolen Helm mit blauem Visier unter dem Arm hielt, fragte ich nach unserer maximalen Geschwindigkeit: 180 km/h. Aber die Maschine fährt an die 300 km/h. So mutig bin ich noch nicht…
Übrigens: Jeannette, unsere Dozentin, hat uns ihre Angst in Form einer großen, aus blauem Filz ausgeschnittenen Eule vorgestellt: „Das ist der Rudi.“ Wir habe alle geschmunzelt, denn es war fast so, als hätte sie sich mit Rudi angefreundet.
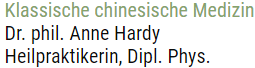
 anne hardy
anne hardy Fotolia 87263751
Fotolia 87263751 Fotolia_92945983_S
Fotolia_92945983_S
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!